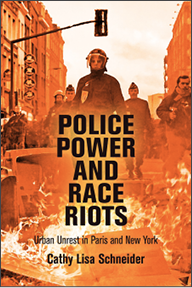
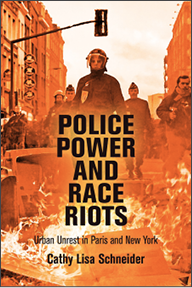
Dieses Buch wirkt wie der Begleitband zu einer Reise, die ausweislich der Autorin mehr als 15 lange Jahre gedauert hat. Es erhebt den Anspruch, von den riots der 1920er Jahre bis zu denen in den Pariser Banlieues (und darüber hinaus) im Jahr 2005 einen umfassenden Überblick zu den Konfrontationen zwischen (weißer) Polizei und urbanen Minderheiten in den USA und Frankreich zu geben, um sodann Paris und New York genauer in den Blick zu nehmen. Tatsächlich beginnt der Band mit dem riot im New York des Jahres 1935 und der tödlichen Hetze gegen Algerier in Paris im Jahre 1961. Auf diese Weise eröffnet das Buch etwas disparat. Zudem wird der (vermeintliche) Beginn der Erzählung in den 1920er Jahren[1] nicht begründet und wirkt daher etwas willkürlich gewählt – mit Folgen (vgl. dazu unten). Zusammengefasst und einen anderen politischen Reisebericht zitierend:
I wouldn’t start from here (Mueller 2008). Doch der Reihe nach.
In vier Kapitel und eine 40-seitige Einleitung untergliedert, kommt der Band mit drei Seiten zur Methodik aus: Basierend auf Interviews, teilnehmender Beobachtung und beobachtender Teilnahme, selektiver Konsultation von Sekundärliteratur und Aktivismus in beiden Ländern habe sie ihre Ergebnisse erarbeitet. Die Autorin kümmert sich, anders als etwa Abu-Lughod in ihrem Band zu race riots in Los Angeles, New York und Chicago (2007), auch weniger um demographische Entwicklungen in ihren Untersuchungsländern und -städten, sondern will den Lesenden einen Eindruck von ‚vor Ort‘ vermitteln. Das gelingt insbesondere in den Beschreibungen der diversen Basisinitiativen in beiden Städten. Schneider treiben drei zentrale Fragen um:
Ihre Antwort auf die erste Frage, im ersten und zweiten Kapitel jeweils für die USA bis 1993 und für Frankreich bis 2002, beginnt sie nicht etwa mit Unterschieden, sondern mit sozioökonomischen Gemeinsamkeiten beider Länder. Die USA und Frankreich seien entlang rassi(sti)scher Linien strukturiert, in Frankreich allerdings geprägt durch eine größere muslimische community und einen so eher religiös konnotierten Rassismus. Gleichwohl führten die kulturellen, sozialen, politischen und ökonomischen Ungleichheitsstrukturen zusammen mit den Anforderungen der jeweils herrschenden Klasse an ‚ihre‘ Polizei zu „erstaunlich ähnlichen Interaktionen zwischen Polizei und Teilen der Minderheitsgesellschaft“, die auf der Kategorie Rasse basieren (2014: 8). Die Konstruktion und gegebenenfalls Aktivierung von kategorialen Grenzen basiere dabei auf ähnlichen (und eben nicht unterschiedlichen, wie die erste Frage suggeriert) sozioökonomischen Entwicklungslinien, nämlich zuvörderst dem Bedarf an männlichen Lohnarbeitern. Die Konsequenzen der Massenmigration in den Norden der USA, die um 1870 begann – von „umfangreiche[n] Wellen schwarzer Migranten“ schreibt Schneider (ebd.: 39) –, sind dabei ein Ausgangspunkt. Ein weiterer ist für sie Mobilisierung von 300.000 Algeriern, Marokkanern, Tunesiern und weiteren 175.000 „schwarzen afrikanischen Soldaten“ für den Ersten Weltkrieg durch die französische Kolonialmacht sowie von zusätzlich „200.000 Kolonialarbeitern“ für den dem Krieg nachfolgenden Arbeitskräftebedarf (ebd.: 92).
Dass Frankreich (Kolonialmacht) und die USA (Kolonie) eine gemeinsame, wenn auch widerstreitende Kolonialgeschichte verbindet, wird von Schneider nicht thematisiert, doch sie zeigt, dass und wie Rasse die zentrale Ausschlusskategorie in beiden Ländern geworden und auch geblieben ist. Sie verweist dabei auf die zunehmende Segregation, urbane Armut und Ghettoisierung in beiden Ländern – jeweils orchestriert durch verschiedene Wohnungsbau- und Abrissprogramme in den USA seit den 1930er und in Frankreich seit den 1950er Jahren. Dass sich in den USA die zu ‚gefährlichen Klassen‘ stilisierten Gruppen vor allem in verödenden Stadtzentren, in Frankreich jedoch am Stadtrand konzentrierten, wird die Autorin wissen; zum expliziten Thema macht sie das nicht.
Polizeigewalt und die Gegenmobilisierungen der Minderheiten führten in beiden Ländern in den nachfolgenden Jahrzehnten zu intensivierten rassistisch motivierten Konfrontationen und riots gegen eine mehr oder weniger rein weiße Polizei. In den USA wurden etwa zwischen 1964 und 1968 zwischen 200 und 500 riots gezählt, bei denen für 190 Tote insbesondere die Nationalgarde verantwortlich war: Watts (1965) mit 28 toten Schwarzen, Newark (1967) mit 24 und Detroit (1967) mit 36, um einige Zahlen zu nennen. Der riot in Los Angeles (1992) forderte insgesamt 53 Tote und war mit einem Sachschaden von 1 Mrd. US-Dollar einer der ökonomisch destruktivsten der jüngeren Vergangenheit (Gilje 1996: 158ff.). Lesenswert für den französischen Kontext ist etwa der kurze Abschnitt, in dem Schneider schildert, wie französische Polizei und Sicherheitsdienste am 17. Oktober 1961 protestierende Algerier nicht nur niederknüppelten, erschossen und folterten, sondern, so malträtiert, gefesselt in die Seine warfen (2014: 106ff.).
Wie zu erklären ist, dass riots in den USA in den 1960er Jahren und in Frankreich 2005 ‚die‘ Antwort auf die anhaltenden Diskriminierungen zu sein schienen, ist für Schneider klar: Die Aktivierung von auf Rasse basierenden Grenzen sei dafür verantwortlich, also „jene seltenen, einzigartigen Momente, in denen jegliche soziale Interaktion sich einzig nur noch um die Grenze von wir/sie dreht“ (2014: 25). Die daraus resultierenden riots fänden ihre Grundlage in eben der ignorierten und, mehr noch, offiziell geforderten Polizeigewalt. Gleichzeitig sei in beiden Städten den Polizeiopfern der Zugang sowohl zu juristischen Verfahren als auch eine juridische Wahrnehmung versagt worden (ebd.: 30f.).
Für die Stadt New York im Jahre 1964 kämen als zusätzliche Ingredienzien für die riots hinzu, dass die schwarzen und puertoricanischen Nachbarschaften durch die white flight ebenso ökonomisch geschwächt und entleert, wie ihre bauliche Infrastruktur durch die sogenannten urbanen Erneuerungsprogramme und den Bau von Schnellstraßen und Autobahnen verwüstet worden seien. Im Paris desselben Jahres hätten die unterdrückten Debatten über rassistische Dynamiken von Polizei und Mehrheitsgesellschaft mit der Leerformel der egalité républicaine sowie der Niedergang revolutionärer Organisationen – wie der Algerischen Front de Libération Nationale (FLN) – für das Ausbrechen von riots einen ähnlich grundierenden Effekt gehabt (Kapitel 3 und 4).
Was die Antwort auf die dritte Frage angeht – warum anhaltende Polizeigewalt in New York nicht zu mehr riots führte –, dürfte sie wohl die umstrittenste sein. Denn in New York, so Schneider, seien die Entwicklung spezifischer sozialer Bewegungen seit den 1970er Jahren und „die Möglichkeit zum Zugang zum Recht“ (2014: 164) dafür verantwortlich. New Yorks soziale Bewegungen und Nachbarschaftsnetzwerke hätten begonnen, ein gewaltfreies „standardisiertes kollektives Aktionsportfolio“ (ebd.: 252) auf- und auszubauen, das aus Protestmärschen, Anträgen, Petitionen und Berufungsgerichtsverfahren auf Distriktebene bestanden hätte. Zusätzlich sei die Bundesebene legislativ zu Interventionen aufgefordert, Zivilklagen angestrengt und die Gründung von grassroots-Organisationen gegen Polizeigewalt forciert worden – alles Dinge, die nach Schneider in Paris und insgesamt in Frankreich deutlich unterentwickelt seien. Unter französischen Städten, inklusive der Pariser Banlieues, wo soziale Bewegungen und mit New York vergleichbare Bewegungsrepertoires fehlten (dafür aber Islamophobie viel verbreiteter sei), stelle nur Marseille eine Ausnahme dar. Dort seien die sozioökonomischen Disparitäten nämlich „nicht durch rassische oder räumliche Grenzen verstärkt worden“ (ebd.: 223). Zudem sorgten „dort die Mafia und eine eng mit ihr verbundene politische Maschinerie“ (ebd.: 222) dafür, dass die Stadt nicht in dem Moment in Flammen aufgeht, wenn rassische Grenzen aktiviert werden.
Es ist wohl wahr, dass die Nachbarschaften in New York ihre je eigene Geschichte mit kollektiven Erinnerungen und tief eingeschriebenen Kulturen haben, wie Schneider sie mit großer Sympathie beschreibt. Warum dann aber die „auffallend ähnlichen“ Pariser Banlieues (2014: 199) kein solches territoriales Selbstverständnis mit entsprechender Identität ausgebildet haben sollen (Fassin 2013), bleibt Schneiders Geheimnis. Mehr noch: Gerade daraus könnte sich der Wille entwickelt haben, seine pockets of poverty gegen sogenannte Fremde – und in Sonderheit gegen die verhasste Polizei – mit, nennen wir es, riotösen Mitteln zu verteidigen.
Dass Schneiders Buch zu einer Zeit erschienen ist, in der nahezu wöchentlich in den USA unbewaffnete Schwarze von der mehrheitlich weißen Polizei am helllichten Tag hingerichtet werden (und wurden), hat dem Buch ein gewisses Maß an medialer Aufmerksamkeit beschert. Einige Fragen an die analytische Tiefe des Bandes aber bleiben. Zwar erwähnt sie richtigerweise die Entscheidungen des Supreme Court, die zu einer gewissen zivilisatorischen Einhegung der Polizei ab den 1960er Jahren beigetrugen, unterschätzt aber systematisch ihren historischen und strukturellen Zusammenhang mit der Polizei und der Nationalgarde des 19. und frühen 20. Jahrhunderts, die die white race riots systematisch mitgetragen hatten und zu einem Instrument der herrschenden Klasse im Zuge der Industrialisierung geworden waren.
Dass verglichen mit Frankreich der Staat in den USA in Protesten nur selten adressiert wird und dieser Umstand den Rückgang von riots im Zuge der Neoliberalisierung erklären könnte, wird bei Schneider nicht diskutiert. Der in den 1960er Jahren in den USA beginnende war on crime, der nachfolgende war on drugs sowie die jeweils nachfolgenden Masseninhaftierungen Farbiger und die Militarisierung des Polizeiapparats könnten ebenfalls zur „Ruhe an der Heimatfront“ beigetragen haben (Balko 2013), aber Schneider zieht solche Verbindungslinien nicht. Dass seit Erscheinen des Bandes die Zahl der riots in den USA wieder anzusteigen scheint – nicht zuletzt, weil immer wieder beschieden wird, es seien keine Gerichtsverhandlungen gegen schießende Polizeikräfte anzuberaumen (Drehle 2015) –, verweist darauf, wie wenig das Phänomen riots insgesamt noch verstanden ist und kann Schneider vernünftigerweise nicht vorgeworfen werden. Schließlich, wie nicht zuletzt Katz (2012) argumentiert, könnte auch eine spezifische Form von und Zugang zu Massenkonsum zu einer Entpolitisierung von Konflikten nicht nur in ‚gesättigten‘ Suburbs, sondern gerade in globalen „Schaufenster-Städten“ wie New York, beigetragen haben. Obwohl Schneider die Arbeiten von Katz (Schneider 2014: 22ff.) diskutiert, nimmt sie dessen Überlegungen zu diesem Punkt nicht auf.
Es dürfte sich insgesamt also eher um ein Bündel von Ursachen handeln, die die Konjunkturen von riots erklären können, zu denen die Kategorie Rasse sicher auch gehört. Aus dieser Perspektive hat Schneider ein facettenreiches Buch geschrieben. Allerdings verdeckt die erwähnte mediale Einbettung zwei Schwächen des Buchs, wobei eine noch ins Positive gewendet werden kann.
Mehr aus Versehen, so scheint es, ist nämlich eine zentrale These des Buchs, dass heute gut organisierte soziale Bewegungen und Nachbarschaftsinitiativen wie die in New York maßgeblich dafür verantwortlich sind, dass riots eine Marginalie im rassistischen Alltag geworden sind, ohne dass allgegenwärtiges racial profiling, Polizeischikanen und Todesschüsse durch den Staat in Uniform aufgehört hätten – eher schon im Gegenteil. Wenn eine solche Beobachtung zutrifft – und zumindest für das Polizeiverhalten dürfte sie unstrittig sein –, dann spräche sie auch dafür, etwa die Folgen einer Verrechtlichung sozialer Konflikte in den Blick zu nehmen, ohne damit riots zu verklären.
Die zweite Schwäche des gleichwohl übersichtlich strukturierten Reiseberichts ist der Wunsch und die Suche nach ‚der einen großen Erzählung‘, die alles erklären möge, und die Entscheidung, diese Erzählung (vermeintlich) in den 1920er Jahre beginnen zu lassen. Nach Schneiders Empirie sind riots gleich race riots, für die Minderheiten verantwortlich zeichnen. Hätte sie ihren Band und ihre Recherchen ein paar Jahrzehnte früher einsetzen lassen, dann wären besagte race riots in den USA nicht nur eine vorwiegend weiße Angelegenheit der Mehrheitsgesellschaft gewesen, die als street justice juristische Unterstützung und juridische Weihen bekam, sondern auch viel häufiger – und weitaus tödlicher – auftraten als etwa in den 1960er Jahren. Allein zwischen 1828 und 1861 zählte etwa Grimsted (1998) 1.218 riots, von denen allein 147 im Jahr 1835 stattfanden. Der als „East St. Louis Massaker“ bezeichnete riot von 1917, um ein Beispiel näher an den 1920er Jahren zu nennen, hinterließ 43 Tote, davon 39 Schwarze, von denen die meisten auf offener Straße und unter den Augen der Polizei gelyncht wurden (McLaughlin 2005); eine vergleichbar hohe Zahl von Toten gab es nur in Los Angeles des Jahres 1982.
Eine institutionalisierte Polizei befand sich in der Mitte des 19. und im beginnenden 20. Jahrhundert noch in einem embryonalen Zustand und entwickelte sich erst im Laufe der nachfolgenden Jahrzehnte zu dem, was man(n) heute eine professionell organisierte staatliche Institution mit Gewaltlizenz nennt. Dass eben diese US-amerikanische Polizei seit den 1960er Jahren entlang einer militärischen Logik nicht nur materiell aufgerüstet, sondern auch taktisch, strategisch und ideologisch an Kapitalinteressen ausgerichtet wurde und dabei dem rassistischen Kanon verhaftet blieb, kann heute sehen, wer den Blick etwa nach Ferguson richtet oder ein Buch dazu aufschlägt (Fogelson 1971, Balko 2013, für Frankreich Mucchielli 2008). Aus einer auf Kontinuität fokussierenden Perspektive wurde die Lynchjustiz auf offener Straße unter Duldung einer weißen ‚Polizei im Aufbau‘ sukzessive ersetzt durch einen professionalisierten und militarisierten Polizeiapparat, dessen Alltagspraxis auf die Fortsetzung der Lynchjustiz in Uniform hinausläuft. Wer freilich dazu etwas lesen möchte, sollte in historischer Perspektive etwa Texte von Elkins (hier: 2014) oder Graham und Gurr (1969) konsultieren, die diese Kontinuitäten betonen. Ein solcher Blick würde eher für einen ‚Etappensieg‘ eines weißen Repressionsapparats sprechen, der dann in Frankreich weitgehend noch ausstünde. Er würde auch die Frage aufwerfen, ob der ‚Sonderfall‘ Marseille dann nicht ganz anders erklärt werden müsste. Es mangelt also nicht an Fragen.
Volker Eick ist Politikwissenschaftler. Seine Forschungsschwerpunkte sind urbane Sicherheitsregime, Kommerzialisierung von Sicherheit und Workfare.
eickv@zedat.fu-berlin.de
Abu-Lughod, Janet L. (2007): Race, Space, and Riots in Chicago, New York, and Los Angeles. Oxford: Oxford University Press.
Balko, Radley (2013): Rise of the Warrior Cop. New York: PublicAffairs.
Drehle, David von (2015): In the Line of Fire. In: Time Vol. 185(14), 18-23.
Elkins, Alex (2014): ‚At Once Judge, Jury, and Executioner‘: Rioting and Policing in Philadelphia, 1838-1964. In: Bulletin of the German Historical Institute, 27(54), 67-90.
Fassin, Didier (2013): Enforcing Order: An Ethnography of Urban Policing. New York: Polity Press.
Fogelson, Robert M. (1971): Violence as Protest: A Study of Riots and Ghettos. Garden City, NY: Doubleday.
Gilje, Paul A. (1996): Rioting in America. Bloomington: Indiana University Press.
Graham, Hugh Davis / Gurr, Ted Robert (1969): The History of Violence in America: Historical and Comparative Perspectives. New York: F.A. Praeger.
Grimsted, David (1998): American Mobbing, 1828-1861: Toward Civil War. New York: Oxford University Press.
Katz, Michael B. (2012): Why Don’t American Cities Burn? Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
McLaughlin, Malcom (2005): Power, Community, and Racial Killing in East St. Louis. New York: Palgrave.
Mucchielli, Laurent (2008): La frénésie sécuritaire. Paris: La Découverte.
Mueller, Andrew (2008): I Wouldn’t Start From Here. The 21st Century and where it all went wrong. London: Portobello Books.