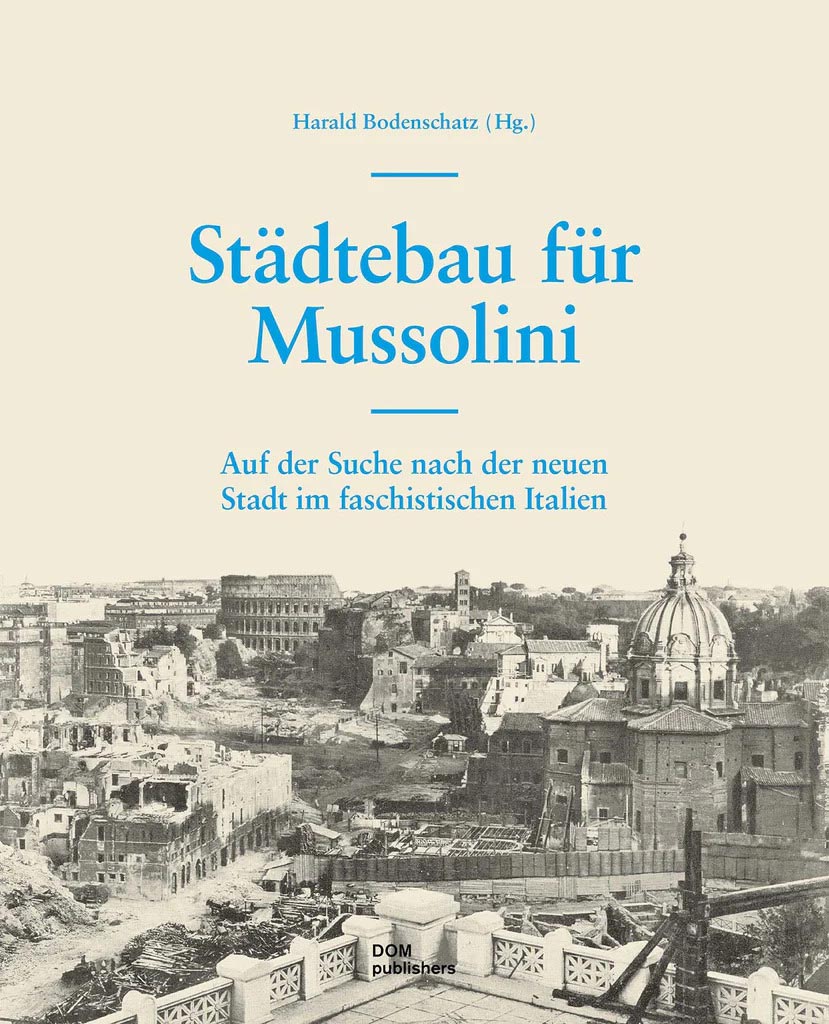
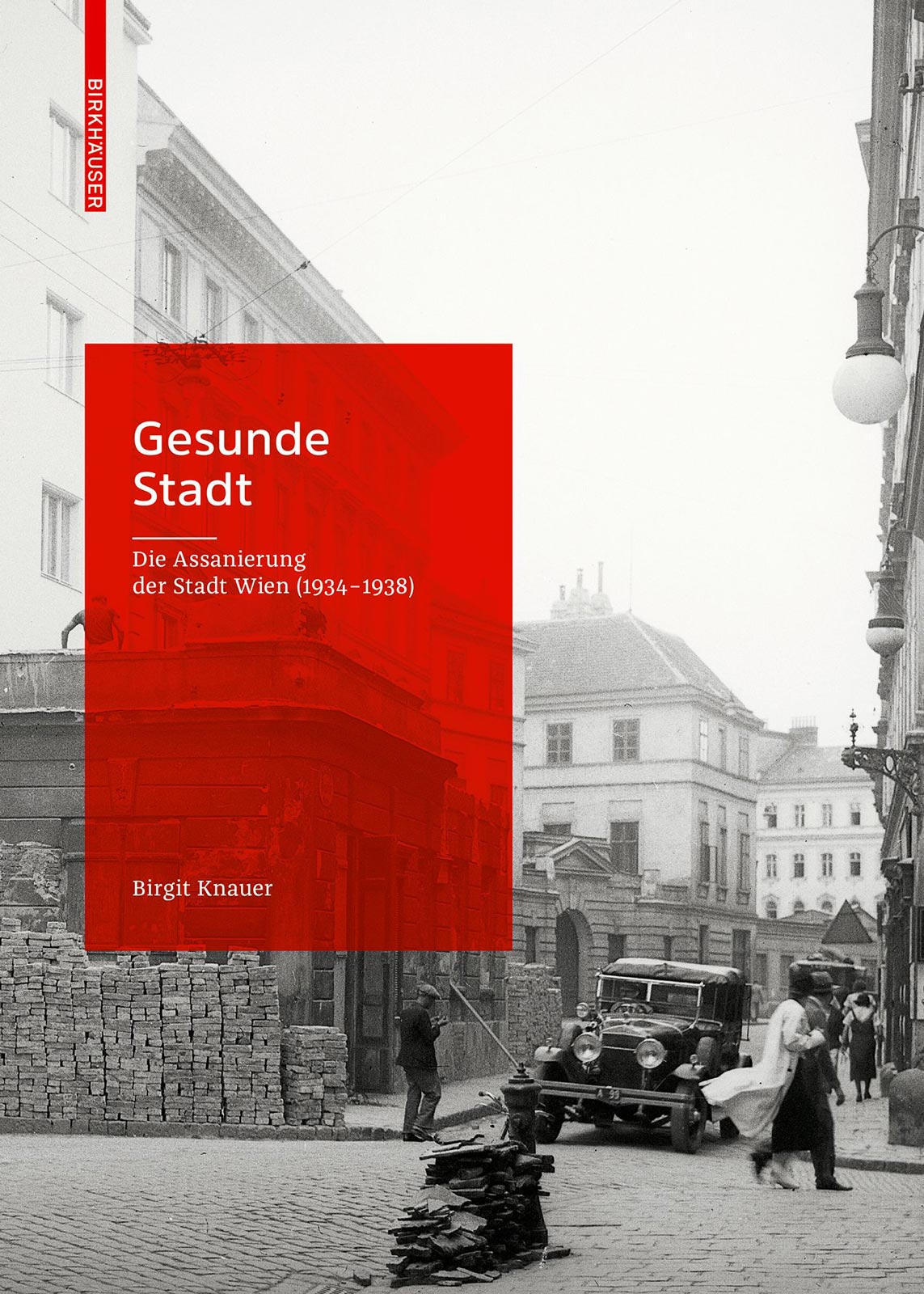
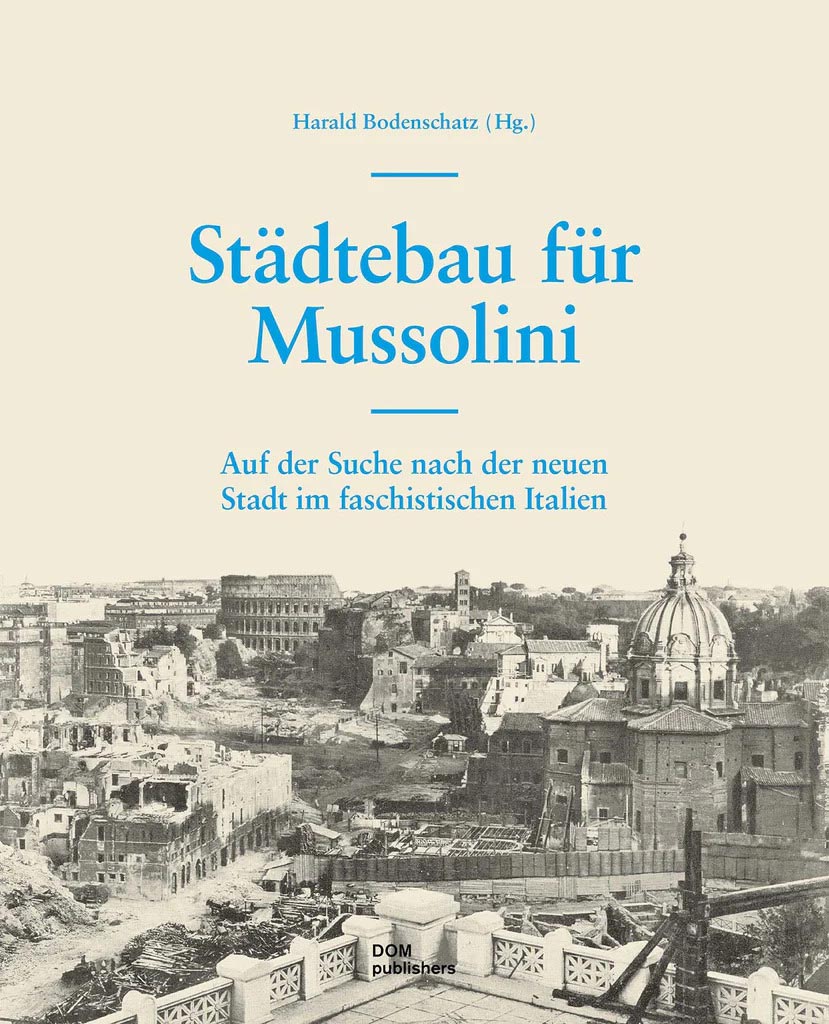
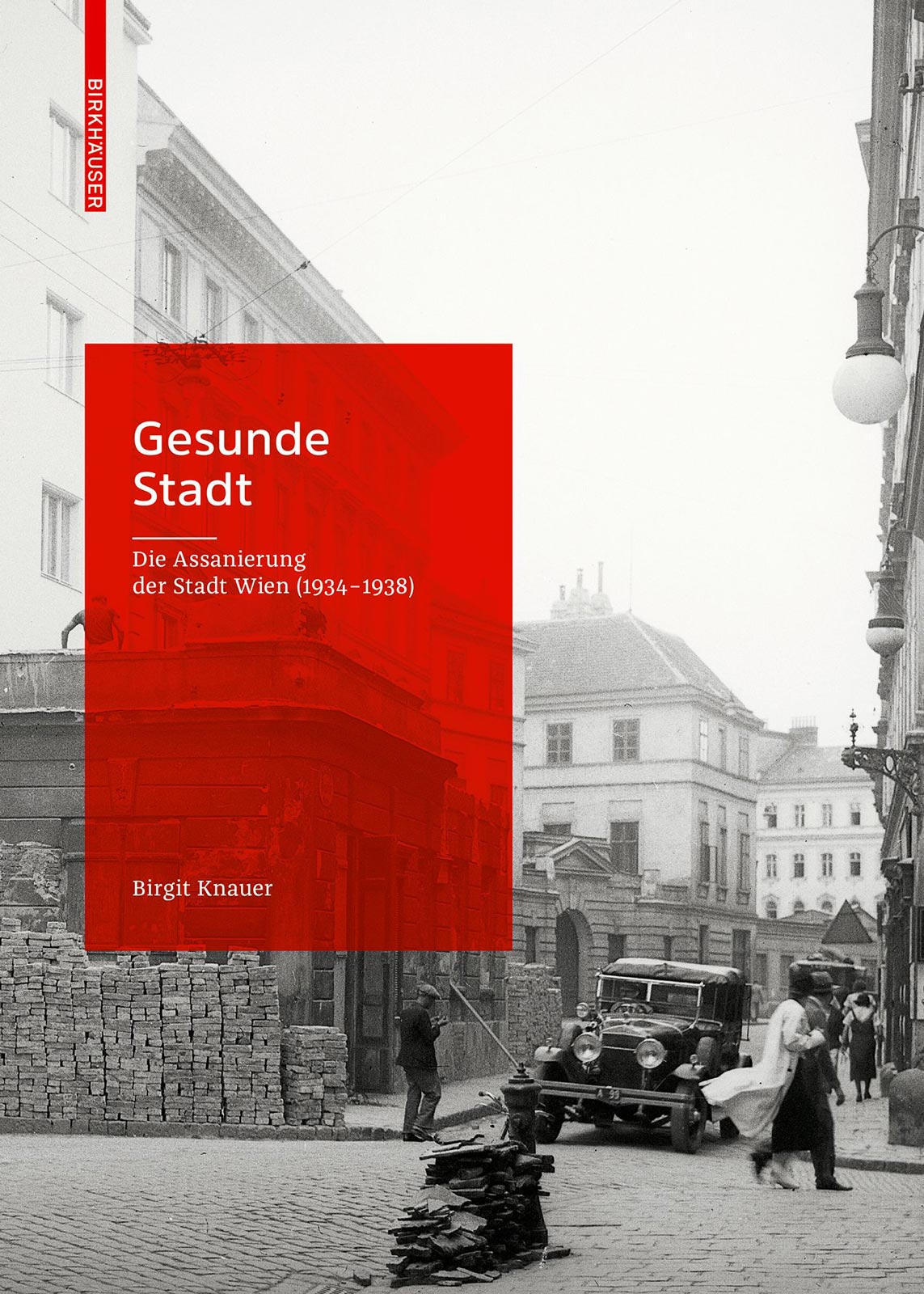
Die Auseinandersetzung um den Umgang mit der bestehenden Stadt führt immer wieder zur Betrachtung ihrer städtebaulichen Genese. Von besonderem historischem Interesse ist dabei die Rolle des Städtebaus in diktatorischen Regimen. Erfreulich ist, dass in den vergangenen Jahren immer häufiger Arbeiten mit dezidiert grenzübergreifendem Blick erschienen sind, die über eine reine Darstellung von Bauten und Projekten hinausgehen. Methodische Grundlagenarbeit hatte das 2011 erstmals erschienene und jetzt neu aufgelegte, von Harald Bodenschatz herausgegebene Werk zum Städtebau in Mussolinis Italien geleistet (Bodenschatz et al. 2022).[1] Bodenschatz plädiert als Herausgeber und Autor zusammen mit seiner Ko-Autorin Daniela Spiegel und weiteren Beiträgen von Uwe Altrock, Lorenz Kirchner sowie Ursula von Petz für die Verknüpfung von architektur- und politikgeschichtlichen Kontextbedingungen, für die Darstellung der internationalen Verflechtungen und für die historisch informierte Kritik der europäischen Erinnerungskultur und damit eine gemeinsame Betrachtung von Produkten und Produktionsverhältnissen von Städtebau in Diktaturen. Dadurch hat das Buch viele darauf aufbauende Studien angeregt. Ein solches Projekt ist die von der Wiener Denkmalpflegerin Birgit Knauer von der Technischen Universität Wien als Promotionsschrift angenommene und im Jahr 2022 veröffentlichte Studie zur „Assanierung“, so der für bundesdeutsche Ohren etwas ungewohnte Begriff für „Stadtsanierung“ in Österreich, der Stadt Wien (Knauer 2022).
In ihrer Studie – die erfreulicherweise parallel als Druck- und als digitale Open-Access-Version bei Birkhäuser erschienen ist – beleuchtet Knauer die Stadtsanierung in der Zeit des sogenannten Ständestaates von 1934 bis 1938. Sie fragt insbesondere nach der städtebaulichen Dimension der Altstadterneuerung sowie nach der Rolle der amtlichen Denkmalpflege, also dem administrativen Verständnis von Stadtbildpflege und Ensembleschutz. Dabei nimmt sie eine explizit europäische Perspektive ein und stützt sich dabei in inhaltlicher wie methodischer Hinsicht auf die Erstausgabe von Städtebau für Mussolini von 2011.
In Deutschland verbindet man mit der Baupolitik Österreichs in der Zwischenkriegszeit vor allem das durchweg positiv rezipierte sogenannte „Rote Wien“ mit seinen bis heute eindrucksvollen Wohnhöfen. Wenig Beachtung findet hingegen das „schwarze Wien“ (Suttner 2017). Bis heute, stellt Knauer fest, sei der durch den austrofaschistischen Ständestaat geprägten österreichischen Hauptstadt in den Jahren 1934 bis 1938 zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt worden (Knauer 2022: 12). Die Autorin erläutert in Gesunde Stadt nun auf Grundlage umfassender Aktenbestände und einer fundierten Analyse zeitgenössischer Publikationen sowie anhand zahlreicher, sorgsam ausgewählter Abbildungen, wie die Altstadterneuerung in Wien als geschichtspolitisches, aber auch modernisierendes Projekt des Regimes durchgesetzt wurde. „Assanierung“ beschreibt dabei die mit kommunalen Mitteln geförderte Erneuerung der bestehenden Stadt durch Sanierungen oder Ersatzneubauten durch Privateigentümer:innen. Dabei ging es nicht nur um eine Verbesserung der Lebensbedingungen, sondern auch um eine angestrebte Befreiung des Stadtbildes von vermeintlich „unharmonischen Zügen“ (Knauer 2022: 10), wozu besonders die Entfernung niedriggeschossiger, aus der Straßenflucht hervorspringender Altbauten zählte. Zudem galten diese als ausgemachte Verkehrshindernisse. Zwei 1934 auferlegte Sanierungsprogramme, der Hausreparatur- und der Assanierungsfonds, dienten als Arbeitsbeschaffungsprogramm sowie dazu, die darniederliegende Bauwirtschaft anzukurbeln. In sechs inhaltlichen Kapiteln schildert Knauer zunächst die Vorgeschichte sowie die wirtschafts- und sozialpolitischen Kontexte der Programme, bevor sie planungspolitische und bauliche Maßnahmen beschreibt. In Kapitel vier und fünf werden Zuständigkeitsdebatten, denkmalpflegerische Bewertungsvorgänge und andere Fachdiskussionen verhandelt. Im sechsten Kapitel wagt Knauer einen Vergleich mit der Altstadterneuerung im faschistischen Italien sowie mit der vermeintlichen „Gesundung“ und sogenannten „Entschandelung“ in NS-Deutschland.
Mit Blick auf die amtliche Denkmalpflege hat sie herausgefunden, dass diese in Personal und Methoden durch eine hohe Kontinuität über politische Brüche geprägt war. Besonders aufschlussreich ist auch aus einer heutigen Perspektive, wie die Denkmalschützer – damals eine ausschließlich männliche Gruppe – zu denkmalpflegerischen Werturteilen gelangten. So stand zu jener Zeit schon das Œuvre des Denkmaltheoretikers Alois Riegl zur Verfügung, der mit seiner Denkmalwerttheorie ein bis heute rezipiertes methodisches System zur Einschätzung von sogenannten Gegenwarts- und Erinnerungswerten von Denkmalen entwickelt hatte. Gleichwohl legt Knauer dar, dass zur Zeit der Generalregulierungsplanung des 19. Jahrhunderts noch kein Wert auf Barockarchitektur gelegt wurde, während in der Zwischenkriegszeit diese Epoche zwar geschätzt wurde, wiederum viele Biedermeierwohnhäuser aber weichen mussten. Nur teilweise wurden hier Denkmalwerte zugeschrieben. Nach Knauer wird so „die Wertverschiebung und die immer wieder aufs Neue notwendige Aneignung und Neubewertung des (Denkmal-)Bestands“ (2022: 222) erkennbar – ein Prozess, der im Grunde bis heute nicht abgeschlossen ist.
Geschichtspolitische Motivationen veranlassten nun auch Bodenschatz und Spiegel, den Band Städtebau für Mussolini erneut aufzulegen und behutsam zu erweitern. Nicht nur war das Buch seit Jahren vergriffen, auch haben neuere Studien den Forschungsstand von 2011 teilweise ergänzt, wie zum Gegenstand des suburbanen Schlichtwohnungsbaus in Bezug auf eine 2012 erschienene Studie konstatiert wird. Der Fall der Neustadt Tresigallo (Emilia-Romagna), der 2011 nicht berücksichtigt wurde, war ein weiteres Motiv der erweiterten Betrachtung (Bodenschatz 2022: 8 f.). Der wichtigste Grund für eine Neuauflage war aber wohl der Anlass des Jahrestags der Machtübernahme Mussolinis am 30. Oktober 1922, der sich 2022 zum einhundertsten Mal jährte.
Die Auseinandersetzung mit der italienischen Erinnerungspolitik stellt zwar einen quantitativ kleinen, in methodischer Hinsicht aber gewinnbringenden Teil der Studie dar. Ein neu verfasstes Kapitel vermittelt den Leser:innen „Erinnerungskultur auf Italienisch“ unter anderem anhand der Universitätsstadt in Rom. Dort wurde vor wenigen Jahren in einem geschichtspolitischen Akt ein Wandgemälde enthüllt, das der futuristische Maler Mario Sironi 1935 gefertigt hatte und das in der unmittelbaren Nachkriegszeit in einem Akt des politischen Neuanfangs übermalt wurde. Diese historische Korrektur war der italienischen Kultur-, Politik- und Wissenschaftselite offenbar ein Dorn im Auge: Man ließ es 2017 restauratorisch in den Zustand von 1935 zurückversetzen. Die Argumentation, konstatieren Spiegel und Bodenschatz, ergibt sich aus einem grundsätzlichen Unterschied in den geschichtspolitischen Wertungen: Während es in Deutschland Tendenzen der bewussten Vergegenwärtigung der Geschichte gibt, beruht die erinnerungspolitische Meinungsbildung in Italien nach der Einschätzung der Autor:innen auf einem betont historisierenden Vorgang. Die Italiener:innen, so zitieren sie den Vorsitzenden der Universitätsstiftung Antonello Biagini, hätten keine Angst vor ihrer Vergangenheit: „Die Vergangenheit ist, wie sie ist, im Guten wie im Schlechten. Vor allem aber ist sie vergangen. Wir sollten sie erinnern, studieren, sie aber nicht für unsere Zwecke verdrehen, geschweige denn sie beseitigen.“ (zitiert nach Bodenschatz 2022: 37) Dass mit Giorgia Meloni ab Oktober 2022 eine faschistische Regierungschefin in Rom regieren würde, konnten die Herausgebenden allenfalls ahnen – es unterstreicht aber die Wichtigkeit dieser historischen Aufklärung.
Die inhaltliche Reverenz von Städtebau für Mussolini muss an dieser Stelle kürzer ausfallen, so gelten die vor etwa zehn Jahren ausgesprochenen Würdigungen im Grunde bis heute (siehe z. B. Bernhard 2012; von Oppen 2012; Welch Guerra 2012). In einem einleitenden Kapitel erläutern die Autor:innen, wie sich Mussolinis Regierung des Städtebaus zur Durchsetzung des faschistischen Projektes bemächtigte. Es stellt einen ersten Überblick dar. Das anschließende erste Schwerpunktkapitel ist mit seinen über 100 Seiten den städtebaulichen Projekten der Hauptstadt Rom sowie den Umbauten rund um den erst seit 1929 in seiner heutigen Form bestehenden Vatikanstaat gewidmet. Im darauffolgenden Abschnitt werden die Neustadtgründungen in den pontinischen Sümpfen behandelt. Die überblicksartige Zusammenstellung zum Städtebau in anderen italienischen Städten sowie im „italienischen Ausland“ ist mit 130 Seiten das umfangreichste Kapitel. Nach wie vor gewinnbringend ist der ehemalige Schluss, der in drei Abschnitten zusammenfassende und interpretierende Überlegungen zur Städtebaugeschichte genau wie zur Städtebauhistoriographie beinhaltet. Zunächst ging es darum, Historiographie und Rezeptionsgeschichte aus internationaler Perspektive zu verorten. So werde beispielsweise deutlich, dass die architektonische „Moderne“ nicht per se für qualitätvolles und progressives Bauen stehen könne. Daneben offenbare der Blick auf die Produktionsverhältnisse des Städtebaus die gesellschaftspolitische Dimension des Städtebaus. Kultur- und sozialpolitische Zielsetzungen hätten vor allem zur Herstellung von Konsens in den aufstrebenden Mittelschichten geführt, während die im Faschismus unerwünschten Bevölkerungsgruppen an die Stadtränder verdrängt wurden. Gesetzgebung, (fach-)öffentliche Meinungsbildung oder Ausbildung dienten dazu, ein hierarchisch gegliedertes sozialräumliches Modell zu formulieren und durchzusetzen. Die Darstellung dieser Produktionsverhältnisse geht über die reine Betrachtung von Bauten und Projekten hinaus.
Ein neues Abschlusskapitel ist dem diktatorischen Dreieck gewidmet, das durch die Sowjetunion, das faschistische Italien sowie NS-Deutschland ausgebildet wurde. Schon der Historiker Patrick Bernhard (2012) hatte in seiner Rezension von Städtebau für Mussolini moniert, dass der europäische Blick nur „unbefriedigend“ eingenommen werde. In der Zwischenzeit ist dahingehend einiges geschehen. In Zusammenarbeit mit anderen Forscher:innen ist in der Folge eine Reihe von hochkarätigen Publikationen erschienen, die weiteres Licht ins Dunkel der verflochtenen europäischen Städtebaugeschichte bringen.[2] Weitere Überblickswerke zur Methode und zu den Quellen einer europäischen, ja globalen städtebauhistorischen Perspektive haben die Debatte in den vergangenen Jahren befruchtet.[3]
Die internationale Perspektive wird auch in Gesunde Stadt eingenommen. Wie anschlussfähig Österreich in den 1930er-Jahren für internationale Debatten war, hat schon Andreas Suttner (2017: 52 f., 193 f.) angedeutet, aber nicht ausbuchstabiert. Knauer wird hier präziser. In Gesunde Stadt schildert sie zum Beispiel die Beteiligung Österreichs an den Kongressen der International Federation for Housing and Town Planning, einer bis heute existierenden Fachorganisation, die 1913 aus der Gartenstadt-Bewegung entstanden war. Österreichische Fachleute waren 1929 auch beim Kongress der Federation in Rom, wo italienische Architekten die Möglichkeit hatten, die städtebaulichen Ergebnisse des faschistischen Regimes zur Schau zu stellen (Knauer 2022: 159). Im europäischen Vergleich wird laut Knauer deutlich, dass in Wien der Weg über die privatwirtschaftliche Initiative mittels öffentlicher Fördermittel eingeschlagen wurde, während die öffentliche Hand in anderen Ländern verstärkt selbst als Bauherrin aufgetreten ist. Ansonsten seien die Diskussionen eher spät in Österreich angekommen (ebd.: 224).
Dass das austrofaschistische Regime in Österreich wiederum keine ganz unbedeutende Rolle im Zusammenspiel der europäischen Mächte spielte, zeigt sich daran, dass das neue Schlusskapitel in Städtebau für Mussolini gleich zwei Mal die ambivalente Rolle des Ständestaates für das Ausbilden der deutsch-italienischen Achse benennt. Die Autor:innen gehen zusätzlich auf den von Josef Hoffmann und Robert Kramreiter geplanten Biennale-Pavillon in Venedig ein, der 1934 – im Jahr seiner Fertigstellung – wohl auch von Adolf Hitler bei seinem ersten, inoffiziellen Besuch in Italien besichtigt wurde (Bodenschatz 2022: 481 f.).
Bodenschatz und seine Mitautor:innen (ebd.: 10 f.) betonen zu Recht, wie wichtig eine nach städtebaulichen Produkten differenzierte Betrachtung ist: So seien es nicht nur die monumentalen Großprojekte eines „triumphierenden“ Städtebaus, die das bauliche Schaffen eines Regimes ausmachen, sondern vor allem ein Spektrum auch an weniger spektakulären Bauvorhaben. Das gilt nicht nur für das faschistische Italien. Die Altstadterneuerung in Wien ist mehr als nur ein illustrierendes Beispiel, sondern Ausdruck der Vielschichtigkeit des Gegenstandes sowie der Herausforderungen der Historiographie. Die bei Bodenschatz neu verfasste knappe Darstellung des Alpenwalls – gewissermaßen der Schlussakkord der zweiten Auflage von Städtebau für Mussolini – kann hier weitere Ansätze für diese Vielschichtigkeit liefern: So ließ das italienische Regime vier Monate nach dem Überfall auf Polen „in aller Stille“ (Bodenschatz 2022: 489) militärische Befestigungsanlagen an der neuen deutsch-italienischen Grenze errichten. In Zukunft wird die europäische Dimension des diktatorischen Städtebaus weitergehend auf der Ebene jenseits der repräsentativen Großprojekte und der spektakulären Planungen zu beschreiben sein. In den vergangenen zehn Jahren ist dahingehend schon einiges geschehen, aber zum Beispiel das Lagersystem als Raumkonfiguration, der kriegsbedingte, militärische Städtebau, „Topographien des Widerstands“ (Gethmann/Indrist 2022) oder nicht zuletzt die europaweite Bedeutung der Zwangsarbeit für den Städtebau sowie des Städtebaus für die Zwangsarbeit verlangen in Zukunft nach einer näheren Betrachtung.
Beide Bücher zeigen, wie wertvoll der städtebauliche Blick bei der Beschreibung vergangener Gesellschaftssysteme sein kann. Die Verräumlichung von Gesellschaftspolitik (vgl. Bernhardt 2017) über die Darstellung der Bauten und Projekte im Lichte der herrschenden Produktionsverhältnisse verhilft entsprechend zu besonderen Einblicken in die Raumproduktion, die wie kaum ein anderer Gegenstand in die Gegenwart hineinragt. Das Werk von Bodenschatz und Autor:innen wird weiter breit rezipiert werden.
Das Buch von Knauer ist das Ergebnis einer wertvollen Studie zur Rolle der Denkmalpflege in Wien und damit in diesem Fall kommunaler Akteure für die Städtebaugeschichte. Es beleuchtet mit der Altstadterneuerung einen aufschlussreichen Aspekt der – zumindest in Deutschland wenig bekannten – städtebaulichen Entwicklung Österreichs bis 1938. Wie schon nach Suttners Buch zum „schwarzen Wien“ fällt aber das historische Urteil zum Austrofaschismus schwer. Bei aller produktiven Beschreibung der Rolle der Denkmalpflege bei der Assanierung wird bei Knauer nur in Umrissen deutlich, welche politische Funktion der Städtebau für das Regime erfüllte. Zur Beschreibung beispielsweise des regimestabilisierenden Charakters der Altstadterneuerung sowie zur Bedeutung der Mittelschichten und ihres Wohn- und Arbeitsmilieus für die austrofaschistische „‚Österreich‘-Ideologie“ (Staudinger 2005) wäre im Abschlusskapitel Platz gewesen. Dieses fällt mit drei Seiten jedoch zu knapp aus. Auch die Einbindung der Zentralstelle für Denkmalpflege in das autoritäre Regime als kommunale Einrichtung wäre an dieser Stelle von Interesse gewesen. Knauer erläutert lediglich die Dezimierung der Ressourcen und des Personals ab 1934. Die Auflösung des Bundesdenkmalamts und die Überführung der neu gegründeten Zentralstelle für Denkmalpflege in das Ministerium für Unterricht könnten aber als Schritt zur Durchsetzung des neuen Regimes lohnende Anknüpfungspunkte für analytische Betrachtungen beinhalten.
Beide Werke sind fundierte Auseinandersetzungen mit der Genese der städtischen Landschaft in Europa und stellen eine einzigarte gesellschaftspolitische Analyse in der Rückschau dar, die uns heute noch lehrt, wie sich Krisenerfahrungen und Identifikationsvakua mit Sozialgesetzgebungen und einer mehr oder weniger steuernden Wirtschaftspolitik zu einem diktatorischen System ausweiten können. Beide Bücher beleuchten zudem nachvollziehbar, welche Rolle das Verhältnis zum Beispiel von Sprache und Tat innehat, insbesondere im Zusammenspiel von Vergangenheitsverklärung, Krisendiagnosen und Zukunftsnarrativen (vgl. Graf 2020). Die Regime sind schließlich auf städtebauliche Projekte sowohl als Propaganda als auch als Infrastruktur angewiesen. Dass dabei wirtschaftsliberale, ordnungspolitische und autoritär-korporatistische Maßnahmen teilweise parallel existieren können, ist kein Widerspruch, sondern eine der grundlegenden Bedingungen für Städtebau in Diktaturen. In ihrer europäischen Perspektive zeigen sie, wie wichtig das Aufzeigen von Gemeinsamkeiten, Unterschieden und Verflechtungen ist. Es entsteht ein vielfältiges und differenziertes Bild, das sich am Gegenstand der Altstadterneuerung anschaulich erzählen lässt – und vor Ort bis heute fortbesteht. Publikationen wie die hier besprochenen helfen dabei, diese Geschichte zu erkennen und als Erbe zu vergegenwärtigen.